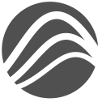Frequenz und Zeit im Funkwerk Erfurt
Von Gisbert Krusche (von 1966 - 1990 Laborleiter in der Messgeräteentwicklung des Funkwerks)
Inhalt
Vorwort
Die weltweit verwendeten und eng miteinander
gekoppelten Einheiten Herz und Sekunde
haben bereits zur Gründung des Funkwerks 1947
eine bedeutende Rolle gespielt.

Nach dem 2. Weltkrieg mit den riesigen Zerstörungen bestand ein großer Bedarf an Messgeräten für den Aufbau der Rundfunkindustrie, der durch die neu hinzugekommenen UKW Sender und Empfänger und in der Folge auch der Fernsehtechnik im VHF - Frequenzbereich weltweit Forderungen nach diesen Geräten auslöste.
Für die Frequenz muss man eine Zweiteilung vornehmen: Einmal die Erzeugung von Frequenzen, also Frequenzgeneratoren, auch Messsender genannt, zum anderen die Geräte welche die eigentliche Frequenz möglichst genau messen.
Betrachtet man nun den zweiten Begriff Zeit und seine Historie im Funkwerk Erfurt, muss man auch hier wieder eine Zweiteilung vornehmen: Einmal die direkte Anzeige der Uhrzeit und zum anderen die Messung von Zeitabschnitten, also von Zeitintervallen und Periodendauern.
Frequenzerzeugung
Die ersten Messsender aus dem Funkwerk orientierten sich natürlich noch an den damaligen Lang- Mittel- und Kurzwellen - Sendefrequenzen (L-M-K) von 30 kHz bis 30 MHz.
Die Geräte der L-M-K Sender waren grundsätzlich Amplitudenmoduliert (AM),
bei den UKW - Generatoren kam die Frequenzmodulation (FM)
zur Anwendung und bei den Fernsehgeneratoren wurde die
Videomodulation (VM) notwendig. 1964 kam
der AM-FM-VM Messgenerator Typ 2039
in den Handel, der alle Modulationsarten beherrschte.
Darüber hinaus wurde dieser Generator auch mit unterschiedlichen
Ausgangsimpedanzen (50, 60, 75 Ohm) angeboten.

Ab 1969 wurde in einem Studienthema an dem Nachfolgegerät Typ 2520 entwickelt, das als Synthesegenerator bis 30 MHz die Ablösung des Typ 2510 bringen sollte. Auf Grund der Festlegung des RGW (Rat der gegenseitigen Wirtschaftshilfe der sozialistischen Länder) wurde eine Spezialisierung der Messgeräte auf die einzelnen Länder beschlossen und der Komplex Messgeneratoren der Sowjetunion zugeordnet. Die begonnenen Entwicklungen im Funkwerk wurden ab 1.1.1970 abgebrochen und künftig nur noch digitale Messtechnik entwickelt und produziert. Die laufende Produktion der analogen Messgeräte lief in den Folgejahren langsam aus.
Neben den Messgeneratoren wurden auch NF - Generatoren (Breitbandgenerator Typ 2016, Tieftongenerator Typ 2012 und Tonfrequenzgenerator Typ 205) bereits ab den 1950er Jahren produziert, sodass man sagen konnte, dass das Frequenzspektrum von 1 Hz … 300 MHz bis 1970 aus dem Funkwerk Erfurt geliefert wurde.
| 1950 | Typ 159 | L-M-K Frequenzgenerator | Amplitudenmoduliert (AM) |
| 1950er | Typ 205 | Tonfrequenzgenerator | NF - Generator |
| 1952 | Typ 262 | Tonfrequenzgenerator | NF - Pegelgenerator, 2 Hz - 20 KHz, Pegel -2 bis +2,7 N (Neper) |
| 1950 | Typ 2159 | L-M-K Frequenzgenerator | Amplitudenmoduliert (AM). Nachfolger des Typ 159 |
| 1950er | Typ 2012 | Tieftongenerator | NF - Generator |
| 1950er | Typ 2016 | Breitbandgenerator | NF - Generator |
| 1952 | Typ 2006 | UKW Messgenerator | Frequenzmoduliert (FM) |
| 1954 | Typ 2001 | HF Leistungsgenerator | |
| 1954 | Typ 2002 | UKW Leistungsgenerator | Frequenzmoduliert (FM) |
| 1954 | Typ 2003 | Fernseh - Messgenerator | Videomoduliert (VM) |
| 1964 | Typ 2039 | AM-FM-VM Messgenerator | Drei Modulationsarten |
| 1966 | Typ 2510 | L-M-K Frequenzgenerator | Amplitudenmoduliert (AM). Nachfolger des Typ 2159, volltransistorisiert |
| - | Typ 2520 | Synthesegenerator | 30 MHz, Nachfolger des Typ 2510. Entwicklung 1970 abgebrochen |
Analoge Frequenzmessung
Die Messung der Frequenzen, also die Messung der Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, erfolgte zunächst auf analogem Wege. Es exisiterten zwei Gruntypen: Überlagerungsfrequenzmesser (auch Wellenmesser genannt) und Absorptionsfrequenzmesser.
Überlagerungsfrequenzmesser (Wellenmesser)

Beim Überlagerungsfrequenzmesser wurde die zu messende Frequenz mit einer bekannten variablen Frequenz verglichen und bei Gleichheit (oder Vielfachem davon) hörte man die Schwebungsfrequenz per Kopfhörer bis zu Schwebungsnull und konnte damit das Ergebnis auf der Skala des oft auch Wellenmesser genannten Gerätes ablesen.
| 1948 | Typ 107 | Analoger Frequenzmesser | Überlagerungsfrequenzmesser |
| 1950 | Typ 121 | Analoger Frequenzmesser | Überlagerungsfrequenzmesser |
| 1968 | Typ 121b | Analoger Frequenzmesser | Überlagerungsfrequenzmesser |
| 1969 | Typ 3017 | Analoger Frequenzmesser | Überlagerungsfrequenzmesser, Nachfolger des Typ 121b, volltransistorisiert. |
| 1969 | Typ 7025 | Analoger Frequenzmesser | Einschub im Typ 3017 zur Erhöhung der Empfindlichkeit um 20dB. Frequenzbereich 28 - 300 MHz. Volltransistorisiert. |
Absorptionsfrequenzmesser
Bei der zweiten Methode wird die zu messende Frequenz an einen Schwingkreis, bestehend aus Drehkondensator und mehreren Spulen angekoppelt. An den Schwingkreis wird lose eine Gleichrichtung mit Anzeige (z.B. Zeigerinstrument) angeschlossen.
Durch Veränderung des Drehkondensator und der unterschiedlichen Spulen wird die Resonanzfrequenz gesucht, die durch ein Maximum in der Anzeige angezeigt wird und an einer Skala des Drehkondensators abgelesen werden kann.
| 1952 | Typ 182 | Analoger Frequenzmesser | Absorptionsfrequenzmesser |
| 1964 | Typ 3014 | Absorptionsfrequenzmesser | Absorptionsfrequenzmesser, volltransistorisiert. |
Digitale Frequenzmessung
1. Generation

Das Ende der analogen Frequenzmessung wurde 1961 mit der Einführung der ersten digitalen Geradeauszähler Typ 3501 und Typ 3504, dem Zeitintervallmesser Typ 3502, allerdings mit einer bescheidenen oberen Grenzfrequenz von 100 kHz jedoch mit einer wesentlichen höheren Genauigkeit, eingeläutet. 1965 kam dann bereits der erste volltransistorisierte Zähler Typ 3514 in die Produktion, der schon bis 1,5 MHz zählen konnte und zwei Jahre später schaffte der Typ 3515 bereits 15 MHz. Diese Geräte wurden als 1. Generation bezeichnet.
| 1961 | Typ 3501 | Digitale Geradeauszähler | |
| 1961 | Typ 3504 | Digitale Geradeauszähler | |
| 1961 | Typ 3502 | Digitaler Zeitintervallmesser | Bis 100 kHz. |
| 1965 | Typ 3514 | Digitaler Universalzähler | Volltransistorisiert. Bis 1,5 MHz. |
| 1967 | Typ 3515 | Digitaler Universalzähler | Bis 15 MHz. |
2. Generation
Es folgte dann eine 2. Generation, die als Basis die KME 3 - Bauelemente (Hersteller: Keramische Werke Hermsdorf) verwendete.
Auf Glassubstrat wurden in Dünnfilmtechnik Widerstände und Leiterzüge aufgebracht und durch Transistoren, die aufgelötet wurden, ergänzt. Danach wird die Schaltung in ein kleines Aluminiumgehäuse vergossen.
Verschiedene analoge und digitale Funktionsgruppen entstanden so und bildeten eine höhere Integration gegenüber dem bisherigen Leiterplattenaufbau mit diskreten Bauelementen. Zu dieser 2. Generation gehörten Geräte wie z.B. der Zähler S-2101.500, S-2101.510 und S-2101.520, die je nach Ausführung bis 100 MHz arbeiteten.
| 1973 | S-2101.500 | Frequenz - Periodendauermesser | 2,5 MHz |
| 1973 | S-2101.510 | Frequenz - Periodendauermesser | 25 MHz |
| 1974 | S-2101.520 | Frequenz - Periodendauermesser | 100 MHz |
3. Generation
Mit dem Beschluss des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) die Geräteproduktion in die einzelnen Länder zu spezialisieren, wurde ab 1970 die Entwicklung und darauf folgend die Produktion analoger Messgeräte zugunsten der Digitalmesstechnik im Funkwerk eingestellt. Das Funkwerk Erfurt war zuständig für Digitalvoltmeter, Zähler im Frequenzbereich bis 1 GHz und Zeitmessungen ab 1 ns sowie Peripheregeräte.
Die Bauelementebasis wurde sehr schnell
durch die TTL-Schaltkreise (DDR: KME 10) abgelöst,
die vorrangig in den USA und Westeuropa entwickelt
und weltweit kopiert wurden. Das war der Start
der 3. Generation Im Funkwerk Erfurt:
Einheitliches System der Digitalen Messtechnik (ESDM 31).
Hierzu gehörten die sehr erfolgreichen Universalzähler S-2201.000,
der bis 900 MHz arbeitete und der S-2202.500,
der ab 1975 in Produktion ging.

Dank Import- BE aus der Sowjetunion wurde mit dem Vorteiler S-2201.060 im Jahr 1978 die 900 MHz mit großem Aufwand geschafft.
Bei der Entwicklung des Universalzählers S-2201.000 war ursprünglich geplant worden, das Gerätesystem mit zwei unterschiedlichen Quarzgeneratoren anzubieten. Einmal mit dem 10 MHz Quarz PQ 10, den von WF Berlin bezogen wurde und damit eine Genauigkeit von 5x 10-8 / Monat erreichte und zum anderen mit einem 5 MHz Quarz PQ 5, den Carl Zeiss Jena für das Funkwerk entwickelte. Erste Muster zeigten allerdings, dass die Drift des Quarzes zum Teil über der vereinbarten Genauigkeit von 5x 10-9 / Monat lag. Zeiss kündigte den Auftrag wegen zu geringer Ausbeute und damit wurde leider diese hochgenaue Version abgebrochen. Zeiss war auch nicht bereit, äquivalente Quarze aus dem Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet (NSW) zu importieren.
| 1974 | S-2201.000 | Universalzählersystem | Bis 900 MHz |
| 1974 | S-2201.010 | Zähler | |
| 1974 | S-2201.020 | Verstärker | Bis 10 MHz |
| 1974 | S-2201.030 | Verstärker | Bis 100 MHz |
| 1974 | S-2201.040 | Vorverstärker | Bis 100 MHz |
| 1975 | S-2201.050 | Vorteiler | Bis 400 MHz | 1978 | S-2201.060 | Vorteiler | Bis 900 MHz |
| 1975 | G-2202.500 | Universalzähler | Bis 10 MHz |
4. Generation
Ab 1975 begann bereits die Arbeiten für die nächste Generation.
Es war das Ziel ein neues System ähnlich dem S-2201.000, jedoch mit moderneren, höher integrierten Bauelementen zu Entwickeln. Auch wollte man sich mit verschiedenen Interfacevarianten (IEC-Bus und Interface SI 1.2) dem Markt anzupassen.

Das System hatte bereits einen Namen: Zähler S-2401.000. Die Entwicklung war bis zum Prototyp in der Entwicklungsstufe K5 im Jahr 1978 realisiert.
Dann folgte die Weisung der Kombinatsleitung, Geräteentwicklungen zugunsten der forcierten Entwicklung von Testern für die Halbleiterproduktion abzubrechen.
Dieser Entscheid basierte auf der Tatsache, dass Tester aus dem kapitalistischem Ausland generell auf der Embargo Liste stehen und damit der weitere Aufholprozess der DDR im Bezug auf die Halbleiterproduktion ins Stocken gerät.

Als kleines Trostpflaster erwirkte der Betriebsleiter des Gerätewerkes wenigstens zur Absicherung unserer Verpflichtung gegenüber den RGW - Staaten und der DDR, Zähler zu liefern. Dadurch konnte die Entwicklung eines Einzelgerätes mit guten technischen Daten realisiert werden So entstand der Zähler G-2005.500 quasi geduldet und ging im April 1986 in Serie.
Mit dem Ende des Funkwerkes 1990 war es dann ein leichtes, die 1 GHz und Zeitinterwalle ab 1ns mit einem kleinen Schaltkreis im G-2005.520 zu realisieren.
| 1978* | S-2401.000 | Digitaler Frequenzzähler | Entwicklung eingestellt. *Prototyp von 1978 |
| 1986 | G-2005.500 | Digitaler Frequenzzähler | Bis 500 MHz |
| 1986 | G-2005.510 | Digitaler Frequenzzähler | Bis 100 MHz |
| 1990 | G-2005.520 | Digitaler Frequenzzähler | Bis 1 GHz |
Serviceklasse
Anfang der 1970er Jahre berichtete der Leiter unseres Absatzes
von einem Messebesuch im Ausland, dass vermehrt
kleinere Messgeräte angeboten werden, die nicht
der Präzisionsklasse zugerechnet werden können,
die wir im Funkwerk produzieren, sondern
zu einer Art Serviceklasse mit geringerer Genauigkeit gehören.

Die Frage war, ob wir hier mit Entwicklungen einsteigen können. Im Labor Frequenzmesser lief die Entwicklung des Systems S-2201.000, ein Universalzähler der 3. Generation. Die Idee, billigere Geräte für Kunden anzubieten, welche die hohe Genauigkeit nicht benötigen und damit auch nicht bei Servicearbeiten die meist 19 Zoll großen und schweren Geräte rumschleppen müssen, zündete schnell.
Und so entstand eine
Konzeption unter Einsatz der neusten Bauelemente wie z.B.
der kleineren LED-Anzeigen, welche die bisherigen Nixie - Röhren
ablösten.
Es wurde der Zähler G-2001.500 als kleiner (3,3 kg)
tragbarer Zähler mit einer 5 - stelligen Anzeige entwickelt.
Dieser übertraf mit einem Frequenzbereich bis 85 MHz sogar den
bisherigen Zähler Typ 3515 (bis 15 MHz).
Zusätzlich stellte er auch die Betriebsarten Periodendauer,
Impulsbreite und Drehzahl zur Verfügung.

Die Absatzzahlen bestätigten unser Konzept. 4 Jahre später folgte der Nachfolger dieses Zählers: Der G-2002.500 mit einer 7 - stelligen Anzeige, einem Frequenzbereich bis 125 MHz und einem besseren Quarzoszillator mit 10 MHz als Referenz.
Als letzter in dieser Kategorie entstand mit der Wende verbunden noch der Zähler G-2004.500. Bei ihm konnte die obere Frequenzgrenze auf 1 GHz erhöht werden, was mit den jetzt zur Verfügung stehenden Bauelementen kein Problem mehr war. Hier wurde ein TCXO – Quarzoszillator eingesetzt, der eine Alterung der Referenz ± 2x 10-6 / Jahr besaß und damit eine 8 - stellige Anzeige ermöglichte. Er beherrschte Betriebsarten Periodendauer, Drehzahl, Frequenzverhältnis, Zeitintervall, und Pulsbreite. Zeit und Zählen machten diesen Zähler zu einem Universalzähler.
| 1979 | G-2001.500 | Digitaler Frequenzzähler | Bis 85 MHz, 5 - stellige Anzeige, Gewicht 3,3 kg. |
| 1983 | G-2002.500 | Digitaler Frequenzzähler | Bis 125 MHz, 7 - stellige Anzeige, 10 MHz Referenzoszillator. |
| 1991 | G-2004.500 | Digitaler Frequenzzähler | Bis 1 GHz, 8 - stellige Anzeige, TCXO - Quarzoszillator. |
Zeitmessung
Kleinquarzuhrenanlagen
Wenn man in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts sich nach der Uhrzeit erkundigen wollte, so schaute man auf seine Armband- oder Taschenuhr. Auf eine Quarz- oder Funkarmbanduhr konnte damals wohl auf der ganzen Welt niemand schauen.
Wer es etwas genauer wissen wollte, schaltete sein Radio ein und eine Stimme verkündete: Mit dem letzten Ton des Zeitzeichens ist es 12 Uhr. Danach konnte man seine Uhr wieder nachstellen, denn die damaligen Uhren hatten pro Tag Abweichungen bis zu mehreren Minuten.
Wer es genauer haben wollte, musste auf große mechanische Pendeluhren zurückgreifen. Die wurden in Großbetrieben und dort, wo es auf präzise Zeit ankam, wie z.B. bei Bahn, Flugverkehr, Rundfunk und ähnlichen bis 1953 eingesetzt.
Der Vergleich der Zeit erfolgte damals immer durch
den Vergleich der Erdrotation zur Sonne.
1935 wurde die erste Quarzuhr durch die
Physikalisch Technische Reichsanstalt (PTR) entwickelt
und man erkannte 1950, dass die Quarzuhr in ihrer Genauigkeit
besser ist als die Erdrotation, die
durch Gezeiten und Magmaverschiebungen variiert.
Aus dieser Erkenntnis entstand daraus die Einführung der
Schaltsekunde, die eine Korrektur unserer Zeit bedeutete.

Und nun kommt unser Funkwerk in Erfurt ins Spiel. Die vorhin genannten Besitzer der Pendeluhren wollten auch genauere Zeitangaben für ihre Zwecke nutzen und so entstand ein neuer Markt für Kleinquarzuhren. In Deutschland war die Firma Rhode und Schwarz in München als führender Messgerätehersteller der erste, der auf diesen Zug aufsprang. Es entstanden im Laufe der Jahre die Typen XSZ, CAQ, die Weiterentwicklung CAQA und andere.
Auch das Funkwerk Erfurt hielt seine Augen bei Messen und Ausstellungen offen und so wurde in den 1950er Jahren die Entwicklung begonnen, damals natürlich noch mit Röhren. Auf den Markt kam die Kleinquarzuhr Typ 2007 im Jahr 1957 mit einer Genauigkeit von 0,1 Sekunde / Tag, das entspricht etwa 1x 10-6 / Tag.
Das Besondere an der Uhr war der Antrieb des Uhrwerkes,
welches durch einen 1000 Hz Synchronmotor erfolgte.
Dieser Motor wurde bei der Inbetriebnahme der Uhr von einem
separaten kleinen Hilfsmotor auf Nennumdrehung gebracht.
Die Synchronisierung wurde durch das Flackern einer Glimmlampe
angezeigt und man konnte dann den Hilfsmotor abkoppeln.
Damit der 1000 Hz Motor sehr ruhig ohne Unwucht lief,
hatte man im Rotor ringförmig eine Hohlkammer geschaffen,
in der Quecksilber eingefüllt war, und der Motor
dadurch sehr ruhig lief.
In den Folgejahren wurde die Uhr durch zwei Modernisierungen
(Typ 2007a und Typ 2007b) weiter gepflegt und
verkaufsfähig gehalten.

1961 wurde jedoch mit der Neuentwicklung der Kleinquarzuhr Typ 2019 begonnen, die vom Gewicht, dem Volumen sowie der technischen Verbesserung deutlich der alten Uhr überlegen ist. Mit dem Typ 2019 wurde eine neue Generation von Geräten geschaffen, die Röhre wurde durch den Transistor ersetzt. Das Funkwerk war damit, nach Rhode und Schwarz, der zweite Betrieb auf der Welt der eine volltransistorisierte Kleinquarzuhr auf den Markt brachte.
Der problematische Synchronmotor wurde durch
ein einfaches Sekundenspringeruhrwerk ersetzt.
Das Gerät bekam einen internen NC- Akku, damit hatte
die Quarzuhr bei Stromausfall eine Gangreserve von 2 Stunden.
Die oft benötigte 50 Hz Frequenz wurde neu installiert
und als Besonderheit wurde die Uhr auch als
Sonderausführung Typ 2019S für siderische Zeit
gefertigt, d.h. die Uhr lief nach
der Sonnenzeit, die für Astronomen und
Sternwarten von besonderem Interesse sind.
Dadurch konnte z.B. ein astronomisches Fernrohr
über einen 50 Hz Synchronmotor so nachgeführt werden,
dass ein beobachteter Stern nicht im Laufe der Zeit aus dem
Blickfeld heraus wanderte, was bei Langzeitbelichtungen
von Fotos sehr wichtig ist.

Schließlich wurde die Langzeitdrift des Quarzoszillators, der in einem Thermostat auf konstanter Temperatur gehalten wurde, auf 5x 10-8 / Tag verbessert. Es war natürlich notwendig, die genannte Drift des Quarzoszillators zu überprüfen; dazu stand anfangs nur ein betagter Wehrmachtsempfänger Typ Berta zur Verfügung, um auf Langwelle einen Normalfrequenzsender zu empfangen. Quer über den Hof des Funkwerkes war eine etwa 50 m lange Langdrahtantenne gespannt, mit welcher der Empfang des englischen Senders Droitwich, der auf der Frequenz 200 kHz mit einer Genauigkeit von < 5x 10-10 / Tag sendet, ermöglicht wurde. Die Empfangsverhältnisse waren nicht optimal, da der Sender auch ein Programm aussendet und durch die Modulation der Trägerfrequenz Störungen beim Empfang verursachte. Deshalb wurde im Funkwerk ein spezieller Empfänger selbst entwickelt, der nur den Träger mit einer Bandbreite < 30 Hz verarbeitet und damit die Modulation unterdrückt. Der Erfolg war sehr gut.
In der Zwischenzeit sendete auch der deutsche Sender Mainflingen auf der Frequenz 77,5 kHz mit einer noch besseren Genauigkeit von 1x 10-10 / Tag. Der Sender wurde durch die Physikalisch- Technische Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) betrieben und gesteuert. Es lag also nahe, auch für diesen Sender einen speziellen Empfänger zu entwickeln, um damit die Kalibrierung unserer Geräte zu verbessern. Aber auch Kunden der Kleinquarzuhren zeigten Interesse an diesen Empfängern und so entstand ohne große Entwicklungsarbeit eine Kleinquarzuhrenanlage.
Diese beiden Spezialempfänger Typ 5010 (Zum Empfang des Senders Droitwich) und Typ 5011 (zum Empfang des Senders Mainflingen), dazu die Kleinquarzuhr Typ 2019 und der zeitgleich entstandene digitale Universalzähler Typ 3514 sowie der Zählbetragsdrucker Typ 3510 wurden in die Anlage integriert und zur Frühjahrsmesse 1965 in Leipzig als Typ 3700 präsentiert.
Dieser Anlage war aber keine lange Produktion gegönnt, denn der technische Fortschritt hatte das mechanische Baukastensystem (MKBS), als Basis für die Konstrukteure Im Funkwerk erkoren. Und mal ehrlich: In der Anlage wurde eine Menge Luft verkauft. Die höher integrierten Bauelemente, die in der Zwischenzeit auf dem Markt sind, waren ein weiterer Grund das Volumen der Geräte zu reduzieren. So begann nach Abschluss der Arbeiten am Typ 3700 eine Studie für ein neues System, welches variabler dem Kunden dienen sollte.
| 1955 | Typ 2007 | Kleinquarzuhr | Genauigkeit 1x 10-6 / Tag, Röhrengerät |
| 1957 | Typ 2007a | Kleinquarzuhr | Nachfolger des Typ 2007 |
| 1963 | Typ 2007b | Kleinquarzuhr | Nachfolger des Typ 2007a |
| 1964 | Typ 2019 | Kleinquarzuhr | Genauigkeit 5x 10-10 / Tag, transistorisiert. |
| 1965 | Typ 2019S | Kleinquarzuhr | Sonderanfertigung des Typ 2019 mit siderischer Zeit für astronomische Anwendungen |
| 1965 | Typ 5010 | Spezialempfänger | Zum Empfang des Senders Droitwich |
| 1965 | Typ 5011 | Spezialempfänger | Zum Empfang des Senders Mainflingen |
| 1965 | Typ 3700 | Kleinquarzuhrenanlage | Kombination aus den Empfängern Typ 5010 / 5011, Kleinquarzuhr Typ 2019, Universalzähler Typ 3514 sowie Zählbetragsdrucker Typ 3510 |
Mechanisches Baukastensstem MKBS - Getrennte Ausgabe von Zeit und Frequenz

Bisher waren ja die beiden Einheiten Frequenz und Zeit
in den Geräten Typ 2007, Typ 2019 und Typ 3700
jeweils vereint angeboten worden.
Durch das MBKS konnte man nun eine Trennung dieser beiden
Einheiten vornehmen, indem einzelne Funktionsbausteine
kombinierbar zu einem optimalen Einsatz beim Kunden
zusammengestellt werden konnten.
So entstanden zwei Gerätesysteme, die primär
die Frequenz oder die Zeit ausgeben konnten.
Das eine System hieß Zeitgebersystem S-3524.000 in dem zwei
Frequenzgeber unterschiedlicher
Genauigkeit (1,5x 10-6 / Mon. bzw. 5x 10-8 / Mon.)
als Zeitbasis dienen und mit den Modulen Zeitgebereinheit,
Taktgeber, Zeitpunktgeber und
Datumgeber die verschiedensten Zeiteinheiten ausgeben konnten.


Das andere System Quarzgeneratorensystem S-2530.000 griff auf die beiden Frequenzgeber des S-3524.000 zurück und wurde ergänzt durch zwei Frequenzteiler, Rückformer, Trennverstärker,Netzteil und zwei verschieden großen Gehäuse, die ebenso im Zeitgebersystem eingesetzt werden konnten. Damit konnten sowohl Sinus- als auch Impulsfrequenzen im dekadischen Bereich von 100 kHz bis 1 Hz sowie 50 Hz ausgegeben werden. Dem Kunden wurden drei fertig konfigurierte Varianten (S-2530.500, S-2530.510 und S-2530.520) angeboten, mit denen die meisten Anwendungsfälle gelöst werden konnten. Daneben war es möglich, sich eine spezielle Zusammenstellung aus den verschiedenen Baugruppen zu bestellen.
| 1970 | S-3524.000 | Zeitgebersystem | Zwei Frequenzgeber Genauigkeit 1,5x 10-6 / Mon. bzw. 5x 10-8 / Mon. Kombinierbar mit Modulen Frequenzgeber, Taktgeber, Zeitpunktgeber und Datumgeber |
| 1970 | S-2530.000 | Quarzgeneratorensystem | Selbe Frequenzgeber wie S-3524.000. Kombinierbar mit Modulen: Frequenzteiler, Rückformer, Trennverstärker und Netzteil. Zwei verschiedene Gehäusetypen. |
| 1970 | S-2530.500 | Quarzgeneratorensystem | Konfigurationsvariante des S-2530.000 |
| 1970 | S-2530.510 | Quarzgeneratorensystem | Konfigurationsvariante des S-2530.000 |
| 1970 | S-2530.520 | Quarzgeneratorensystem | Konfigurationsvariante des S-2530.000 |
Abgleich mit Referenzfrequenz
Für die Produktion der Zähler war es nötig, eine Referenzfrequenz für den Abgleich bereitzustellen, die möglichst um den Faktor 10 besser war, als die Genauigkeit der Produkte. Jetzt kam die Politik ins Spiel: Man konnte in der DDR nicht abhängig von der Genauigkeit eines kapitalistischen Senders DCF 77 sein, der von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben wurde. Das Funkwerk und auch andere Betriebe importierte aus der Sowjetunion ein Rubidium - Standard, dessen Genauigkeit mit 1x 10-9 / Monat für unsere Produktion ausreichend war. Nach zwei Wochen im Einsatz war das Gerät jedoch schon defekt und wurde zur zentralen Servicewerkstatt für Sowjetgeräte in Mirow (Mecklenburg) zur Reparatur geschickt. Nach 9 Monaten kam das Gerät zurück, gab aber nach kurzer Zeit seine Funktion erneut auf. Anderen Betrieben ging es ähnlich.
Wir hatten in der DDR das Amt für Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung (ASMW) und hier speziell den Fachbereich Elektrizität, Arbeitsgruppe der Fachkommission Zeit und Frequenz in Berlin - Friedrichshagen, mit der das Funkwerk eng zusammen arbeitete, denn alle Zähler mussten eine Typprüfung beim ASMW durchlaufen, bevor eine Freigabe der Produktion erfolgte.
Die größte Genauigkeit einer Frequenz erzielte man mit einem Cäsium - Normal, hier war es möglich, 1x 10-12 / Tag zu erreichen. Diese Art von Gerät stand natürlich wegen der Ost-West Konflikte auf der Embargo-Liste und war für die DDR unerreichbar. Deshalb entschloss sich das ASMW zu einem Eigenbau eines Cäsium - Normals.
Eine kühne Idee! Aber in geheimer Aktion ist das Projekt tatsächlich erfolgreich realisiert worden. Hut ab! Nun hatte zwar das ASMW eine derartige Anlage, aber es bestand auch der Bedarf bei den oben genannten Anwendern nach einer Referenzfrequenz zur Kontrolle ihrer Geräte und Anlagen. In der Arbeitsgruppe Zeit und Frequenz wurden Möglichkeiten der Übertragung einer genauen Frequenz erörtert und schließlich wurde eine geniale Idee mit Hilfe des Deutschen Fernseh Funk (DFF) der DDR realisiert. Man übertrug per Postleitung von Berlin-Friedrichshagen nach Adlershof ein 5 MHz Signal mit der Genauigkeit von 1x 10-12 und bereitete es auf und synchronisierte damit die Zeilen- und Bildfrequenz des Fernsehens. Voraussetzung war, dass die Sendung aus dem Sendezentrum Adlershof kam. Liveübertragungen von Veranstaltungen (z.B. Sport, Theater usw.) hatten dann nicht diese Genauigkeit. Es wurde festgelegt, dass die 12 Uhr Übertragung der Aktuellen Kamera generell für Messungen in der DDR mit der genannten Genauigkeit zur Verfügung steht. Die Abweichungen der Referenzfrequenz wurden jeweils für den vergangenen Monat in der Fachzeitschrift Radio Fernsehen veröffentlicht. So hatte man sich trotz Embargo doch elegant aus der Affäre gezogen und konnte stolz auf diese Leistung sein.
Im Funkwerk Erfurt hatten wir in der Zwischenzeit ein Rubidium - Normal aus München (Rhode und Schwarz) auf dunkle Art beschafft und konnten damit die Produktion der Zähler garantieren. Eine tägliche Kontrolle mit der über das Fernsehsignal ankommenden Zeilenfrequenz war natürlich Pflicht. Nach der Wende wurde dieses Verfahren auch vom ZDF übernommen und erfuhr dadurch noch eine weitere Wertschätzung.
Das Ende der Messgeräteentwicklung in Erfurt
Das Funkwerk Erfurt trug zuletzt den Namen VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt Stammbetrieb, wurde aber umgangssprachlich immer noch als Funkwerk bezeichnet und existierte bis zum 30.06.1990. Hiernach firmierte es unter dem Namen ERMIC (Abk. für Erfurter Mikroelektronik). Ende November 1991 wurde die ERMIC durch die MTG mbH (Abk. für Mikroelektronik und Technologie Gesellschaft) übernommen. Diese wurde von der Treuhand im November 1993 in Liquidation geschickt.
Im Gerätewerk des Funkwerks (interne Abkürzung G) arbeiteten Ende 1989 ca. 1000 Mitarbeiter. Nach Kündigungen, Frühverrentungen und Ausgründungen lief die Produktion mit stark eingeschränkter Belegschaft bis zum 30.11.1991. Im November 1993, zum Zeitpunkt der Schließung durch die Treuhand, waren noch 33 Mitarbeiter im Gerätewerk beschäftigt.